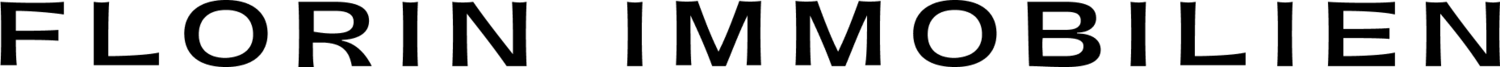Architektur-Ikonen im Hansaviertel: Die Interbau 1957 und ihre Spuren
Ein Viertel für eine neue Zeit
Wer heute durch das Hansaviertel spaziert, hört das Rascheln der Bäume, sieht das Spiel von Licht und Schatten auf den klaren Fassaden und spürt die besondere Ruhe mitten in der Großstadt. Hinter dieser harmonischen Anmutung steckt ein bewusstes städtebauliches und architektonisches Konzept der Nachkriegszeit.
Hier schuf die Interbau 1957 ein Viertel, das den Bruch mit der Vergangenheit markierte und die moderne Stadt ausrief. Internationale Architekten wie Egon Eiermann, Oscar Niemeyer, Gustav Hassenpflug, Alvar Aalto, Walter Gropius, Arne Jacobsen und Hans Schwippert entwarfen Gebäude, die das zerstörte Berlin nicht nur wiederaufbauen, sondern zugleich ein Signal des Aufbruchs senden sollten. Diese städtebauliche Offenheit unterschied sich radikal von den dichten Berliner Mietskasernen des 19. Jahrhunderts und machte das Hansaviertel zu einem Modell moderner Lebensweise.
Die Interbau war von Anfang an mehr als eine Bauausstellung. Inmitten des Kalten Krieges wollte West-Berlin zeigen, dass hier eine offene Gesellschaft entstehen konnte, die nicht auf platzeinnehmende Monumente, sondern auf alltägliche Lebensqualität setzte. Fünfzig Architekten aus dreizehn Ländern wurden eingeladen. Ihre Entwürfe zielten auf Wohnungen, die hell und luftig waren, auf Freiflächen, die Begegnungen ermöglichten, und auf Bauten, die diverse Lebensentwürfe vereinten.
Schon an den Punkthochhäusern wie denen von Hassenpflug, J. H. van den Broek und J. B. Bakema, Lopez und Beaudouin oder Schwippert zeigte sich, wie radikal der Bruch mit der damaligen Berliner Architektur war. Statt endloser Hinterhöfe erhoben sich nun freistehende Türme, die jedem Raum Licht, Luft und Ausblick sicherten. Mit den Hochhäusern begann das Hansaviertel, sich als Labor für neue Wohnformen zu präsentieren. Wohnungen mit verschiedensten Größen und Grundrissen enstanden auf 16 Stockwerken und zeigten auf, was eine neue Ära architektonisch möglich machen könnte.
Eleganz in der Vertikalen – die Punkthochhäuser
Die Punkthochhäuser entlang der Bartningallee setzen markante Akzente im Viertel. Bis heute kann das Hansaviertel aus der Ferne erkannt werden. Die Hochhäuser ragen aus der Mitte der Stadt heraus. Jedes davon bringt seinen eigenen Rhythmus aus Farben, Materialien, Innen und Außen.
An der Hausnummer 9 realisierte Gustav Hassenpflug einen streng gegliederten Bau, dessen klare Fassadengestaltung von einem präzisen Fenster- und Linienraster geprägt ist. Auf den ersten Blick wirkt das Gebäude kompakt, doch bei genauerer Betrachtung offenbart sich das Wechselspiel zwischen Loggien- und Wohnbereichen. Im Inneren setzte Hassenpflug auf funktionale Grundrisse, die den Wohnkomfort maximieren und gleichzeitig durch viele Fenster offene Blickbeziehungen zur Umgebung ermöglichen.
An der Bartningallee 7 errichteten die niederländischen Architekten J. H. van den Broek und J. B. Bakema ein 16-geschossiges Hochhaus mit 73 Wohnungen. Auffällig ist die Split-Level-Konstruktion: Die beiden Wohntrakte sind um ein halbes Geschoss versetzt, sodass größere Wohnungen über zwei Ebenen verlaufen, während kleinere Einzimmerwohnungen direkt vom Flur erschlossen werden. Die Fassade ist klar gegliedert und betont durch vorgefertigte Betonplatten und gleichförmige Fensterformate die rationale Strenge des Entwurfs. Aufgelockert wird das Bild durch farbige Akzente in Rot, Blau und Gelb sowie durch die Loggien, die nicht nur privaten Freiraum schaffen, sondern auch den Erschließungsgängen Licht und Großzügigkeit verleihen.
Auch Hans Schwippert verlieh dem Bau an der Bartningallee 16 eine plastische Fassadenstruktur mit Balkonen sowie Vor- und Rücksprüngen, die das Gebäude lebendig wirken lässt. Die drei gleich großen Wohntrakte sind U-förmig um den zurückgesetzten Erschließungstrakt mit Treppenhaus und Aufzug angeordnet, sodass alle Wohnungen optimal zu den sonnigen Seiten ausgerichtet sind. Im West- und Osttrakt befinden sich zweigeschossige Maisonettewohnungen mit Loggien, die von außen an den zentralen Loggien deutlich erkennbar sind sowie kleinere Einzimmerwohnungen. Der Südtrakt beherbergt große Etagenwohnungen mit Mittelloggia im Wechsel mit weiteren Maisonetten. Vorspringende Schotten und der tragende Stahlbetonrahmen gliedern die Trakte zusätzlich und verstärken die Plastizität der Fassaden.
Die Häuser an der Bartningallee kommunizieren eindrucksvoll die unterschiedlichen Handschriften ihrer Architekten und verfolgen doch ein Leitprinzip: klare Raster, plastische Fassaden und die Idee, das Hochhaus als lichtdurchfluteten, individuell gestaltbaren Wohnraum zu entwickeln. Zugleich nehmen sie die Gestaltung des Viertels in sich wieder auf. Denn auch hier wird Platz für unterschiedliche Lebensentwürfe geschaffen. Während der Interbau wurde dieses Ensemble von Architekten aus aller Welt zeitweise selbst bewohnt, wodurch das Hansaviertel für kurze Zeit zur vielleicht internationalsten Architekten-WG Europas wurde.
Neben den markanten Türmen entstanden auch langgestreckte Scheibenhochhäuser, kleinere Wohnbauten mit zwei oder drei Geschossen sowie Reihenhäuser und Atriumlösungen. Ergänzt wurden sie durch Sonderbauten wie die Akademie der Künste, die katholische Kirche St. Ansgar, ein Gemeindezentrum und ein Kinder- und Jugendhaus, die den kulturellen, sozialen und spirituellen Rahmen des Viertels erweiterten.
Horizontale Leichtigkeit – die Scheibenhochhäuser
Einen Kontrast zu den vertikal markanten Punkthochhäusern bilden die Scheibenbauten. Der brasilianische Architekt Oscar Niemeyer gestaltete an der Altonaer Straße 4–14 eine auf Doppelstützen gestellte Wohnscheibe, deren retro-futuristische Eleganz heute noch beeindruckt. Der ursprüngliche Entwurf Niemeyers wurde von der Berliner Bauverwaltung abgelehnt, da dieser nicht die Vorschriften für sozialen Wohnungsbau erfüllte.
Das direkt gegenüberliegende ‘Schwedenhaus’ von Fritz Jaenecke an der Altonaer Straße 3–9 wirkt auf eine andere Art zeitlos. Das zierliche Raster aus Fenstern und vielen Balkonen erzählt von skandinavischer Klarheit. Besonders sind die verglasten Treppenhäuser, die ein Lichtspiel inszenieren und den Menschen auf den Stufen eine Bühne geben.
Egon Eiermann schließlich realisierte an der Bartningallee 2–4 ein Hochhaus, das bis heute als Inbegriff rationaler Eleganz gilt. Kleine Wohnungen reihen sich sichtbar nach außen durch bausteinartige Balkone. Die roten Ziegel in der Fassade ändern je nach Tageslicht die Farbe und geben dem Gebäude eine warme Ausstrahlung. Sparsamer Wohnraum wirkt hier großzügig und verdeutlicht, wie Schönheit funktional sein kann.
Transparenz und Kultur – die Akademie der Künste
Neben den Wohnbauten setzt die Akademie der Künste im Hansaviertel ein kulturelles Zeichen. Werner Düttmann schuf einen Bau, der mit seinem pavillonartigen, beinahe schwebenden Baukörper mit Waschbetonfassade bewusst auf Monumentalität verzichtet. Hier wurde die Interbau eröffnet, und bis heute ist das Haus ein Ort des Austauschs zwischen Architektur, Kunst und Gesellschaft. Schon in den Anfangsjahren war der lichtdurchflutete Vortragssaal so belebt, dass Anwohner ihn augenzwinkernd „Wohnzimmer des Hansaviertels“ nannten. Seit ihrer Gründung 1696 zählte die Akademie bedeutende Architekten wie Andreas Schlüter, Karl Friedrich Schinkel, Peter Behrens, Ludwig Mies van der Rohe oder Le Corbusier zu ihren Mitgliedern. Heute knüpft sie an dieses Erbe an und bleibt ein lebendiger und zentraler Treffpunkt, der Kultur im Hansaviertel sichtbar und zugänglich macht.
Der Grundgedanke dieses Viertels ist bis heute aktuell. In Berlin wird nach wie vor über Wohnformen und Zugänge zu Wohnraum debattiert, doch das Hansaviertel zeigt, wie Vielfalt gelingen kann. Einzimmerwohnungen in den Hochhäusern stehen gleichberechtigt neben Maisonetten, Atriumhäusern oder kleinen Familiensiedlungen. Wer durch das wandernde Sonnenlicht zwischen den Gebäuden geht, begegnet einer Architektur, die auch nach Jahrzehnten den Anspruch erfüllt, Menschen zusammenzuführen – unabhängig von Herkunft, Lebensstil oder Lebensphase.
Quellen:
Hansaviertel Berlin, www.hansaviertel.berlin, aufgerufen am 27.9.2025
Akademie der Künste, www.adk.de, aufgerufen am 27.9.2025
Denkmaldatenbank, www.denkmaldatenbank.berlin.de/daobj.php?obj_dok_nr=09050387&utm_source=chatgpt.com, aufgerufen am 24.9.2025
Fotos: © Studio Konkret
Helles 2-Zimmer-Apartment im Hansaviertel mit weitem Blick über den Tiergarten →